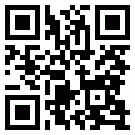Was der Nachwuchs der Film- und Kunsthochschulen und Akademien aus Berlin, Kiel, Köln und Karlsruhe hier ins Rennen geschickt hatte, konnte sich durchaus sehen lassen.
Jakob Schmidts 517 Füwatown. begleitet den Rapper Romano. Hin und hergerissen zwischen seinen Homies und der schwangeren, despotischen Freundin sucht Romano einen Kompromiss zwischen seinem Traum von der Musik und seiner jungen Familie. Statt einer stereotypen Milieustudie beobachten wir den rührenden Versuch des werdenden Vaters, ein romantisches Fertiggerichtdinner zu kochen oder die Suche nach guten Reimen – „meine Faust in dein Darm“ gehört wohl eher nicht dazu. Auch ganz und gar nicht dem Klischee entsprechen die vernünftigen Ratschläge seiner Kumpels, die eifersüchtige Freundin abzuschießen: „…aber um das Kind musste dik kümmern, Alter.“ Man gönnt diesem sympathisch verschepperten Haufen das Happy End durchaus.
Vertical Distraction erscheint hingegen eher wie eine Performance, die zufällig gefilmt wurde. Ob sich hier wirklich mit der Rückwirkung großstädtischer Architektur auf den menschlichen Körper und andersherum beschäftigt wird, sei dahingestellt.
Vielmehr wütet hier eine fleischgewordene, aus dem Kopf von Christo und Jean Claude entsprungene Geisteskrankheit, die demonstriert, wie viel herrlichen Unfug man vor der Kulisse der Frankfurter Skyline mit unzähligen Kilometern durchsichtigen Klebebandes und Sellerie machen kann.
Derlei Humor und Selbstironie hätten die Variationen von Helga Fanderl gut gebrauchen können. 16 Minuten lang grobkörnige, willkürliche Impressionen rauschender Blätter und gekneteter Teigröllchen befreien auch den romantischsten Nostalgiker von einer Aversion gegenüber fortschreitender Filmtechnik und beweisen einmal mehr, dass Schwarz-Weiß nicht automatisch Kunst ist, sondern auch prätentiöse Scheiße sein kann.
Erfreulich hingegen die verdiente Auszeichnung der sympathischen Vanessa Nica Müller für Traces of an Elephant.
Hervorgegangen aus einem Aufenthalt in Belfast, dekonstruiert Müller Alan Clarkes Elephant aus dem Jahr 1989. Der kontroverse Film Clarkes thematisiert den Nordirlandkonflikt, in dem er in willkürlicher Abfolge brutale Morde explizit darstellt. Ohne erkennbare Motivation für die Taten und ohne Opfer und Täter näher zu bestimmen unterstreicht Clarke so die Sinnlosigkeit des ethnischen und konfessionellen Konflikts und der Eskalation der Gewalt. Traces of an Elephant folgt buchstäblich den Spuren Clarkes, besucht die Drehorte von „Elephant“ und lässt verschiedene Personen über ihre erste Begegnung mit dem Film sprechen.
Die Originalszenen bilden dabei den roten Faden, die Mordszenen werden jedoch konsequent ausgespart, so dass nur die Momente unmittelbar davor und die Flucht danach bleiben. Hierdurch baut sich auch für jene, die den Originalfilm nicht kennen und nur rudimentäre Kenntnisse über den Nordirlandkonflikt besitzen, eine bedrohliche Spannung auf, bei der unsere Phantasie die unbeschreiblichen Verbrechen und Leiden der Geschichte Irlands vollständiger zu ergänzen vermag als jedes Geschichtsbuch.
Abschließend sollten noch zwei Beiträge aus der Rubrik Kuriositäten Erwähnung finden, wobei der erste den längsten Titel des Festivals aufweist: ich fahre mit dem fahrrad in einer halben stunde an den rand der atmosphäre…es sind nur 14 km.
Regisseur Michel Klöfkörn kam wie die urbane Variante eines Almöhis auf die Bühne und erklärte sich und sein Werk folgendermaßen: „Wir in Frankfurt stehen morgens auf, ziehen unsere FDP-Hemden an und trinken Rasierwasser“ bevor er wieder verschwand und so perfekt auf seinen Zeichentrickfilm einstimmte, mit dem er laut eigener Aussage nichts weniger versucht, als die Welt zu verstehen.
Bei aller Ablehnung des Schubladendenkens muss auch Max Linz angesichts seines Films Die Finanzen des Großherzogs Radikant Film in die Kategorie der sympathischem Irren sortiert werden.
Es war einmal in einem leerstehenden Schloss in Brandenburg, als ein durchgeknallter Regisseur an sich selbst verzweifelte, sich kurzerhand als Wasserleiche inszenierte und dabei der deutschen Fernsehlandschaft wie auch der ganzen Kunstszene den parodistischen Spiegel vorhielt.
Budget brauchte Max Linz hierzu nicht, eine Nebelmaschine, ein schießwütiger Schlagzeuger mit Downsyndrom und vergammelte Theaterkostüme reichen im völlig, um mittels sinnfreier Dialoge oder Phantasiesprache auf gehobenen Niveau Verwirrung zu stiften. Trash at it’s best.
- Kurzfilmtage 2011 Oberhausen Intro
- Internationaler Wettbewerb
- Deutscher Wettbewerb
- NRW Wettbewerb
- Musik Video Award / MuVi
Maxi Braun
14.05.2011